
Zur Figurenentwicklung schreibe ich oft kurze Texte, in denen ich ausprobiere, wie sich meine Figuren in einer bestimmten Situation verhalten. Diese Geschichte spielt am Tag vor Heilig Abend, etwa fünf Jahre vor der Romanhandlung des „Märzwinter“. Martin Sanders verkauft sein Haus, und auch sonst geht es ihm nicht gut …
Als Polizist kannte er die Statistik zur Häufigkeit und Verteilung von Todesursachen in Deutschland. Die meisten Menschen brachten sich im Sommer in Bayern um. Selbstmord zu Weihnachten in Brandenburg, das war an Originalität quasi nicht zu überbieten.
Martin Sanders sah sich ein letztes Mal in den leeren, kalten Räumen um. Der Rahmen der Küchentür hatte eine winzige Delle dort, wo der Trödler und er im letzten Sommer mit dem unbenutzten Kinderbett angestoßen waren. Die Delle hatte ursprünglich die Form eines Fragezeichens gehabt. Silke hatte ihm Holzspachtel besorgt und auf seinem Platz am Esstisch gestellt, neben seine Post.
Aber im August kam er dann, dieser Tag. Verkehrskontrolle, zuerst nichts besonderes, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, plötzlich werden Waffen gezogen. Sanders stürzte in eine Reflexkette, und zum Schluß war Rocco Lorenzo tot. Erst 12 Jahre alt. Schicksal. Ein Unfall fast. Aber Sanders konnte es nicht zurückdrehen. Natürlich. Danach war auch Sanders Leben vorbei. Verflucht war er. Die Familie Lorenzo hatte Blut von Sanders‘ Blut nehmen müssen. Silke war im neunten Monat, als sie es schließlich taten. Seine Frau musste Sanders Rechnung zahlen.
Silke hatte nie verstanden, warum sie danach noch weiterleben musste.
Die haben mir die Seele rausgeschnitten, hatte sie gesagt.
Aber dass du lebst, hatte Sanders gestammelt. Das ist das Wichtigste.
Was weißt du denn, hatte Silke gesagt.
Wenn du willst, gehen wir weg aus Berlin, hatte Sanders vorgeschlagen. Darum gebettelt, fast.
Aber Silke hatte nur gesagt: Dein Chef hat angerufen. Sie versetzen dich eh in den Innendienst. Falls du überhaupt jemals wieder diensttauglich geschrieben wirst.
Ich sorge für dich, hatte Sanders geantwortet. Ich beschütze dich. So oder so.
Zu spät, hatte Silke geschluchzt.
Und Sanders hatte vor ihr gestanden, plötzlich so wertlos wie das Kinderbett es war oder die hellblauen Babyturnschuhe, Größe 19, ein Geschenk von Silkes Schwester.
Der Herbst kam mit Sprachlosigkeit und knochenkalter Feuchte. Sanders‘ Chef rief immer öfter an und besprach Sanders’ Zukunft mit Silke. Wie von selbst riss das Holz des Rahmens der Küchentür weiter und weiter. Wann immer er den Flur betrat, starrte Sanders auf das Holz, als sei es eine Wetterstation, an der er den Zustand seiner Welt ablesen konnte. Zuletzt hatte das Fragezeichen sich zu einem Ausrufezeichen verlängert. Und jetzt ging es ihn nichts mehr an.
Sanders wandte den Blick vom Türrahmen ab, zog den Hausschlüssel aus der Anzugtasche und ließ ihn in die fleischige Hand des Maklers fallen. In diesem Moment starb die Haut auf seinem Körper. Er spürte, wie die Durchblutung stoppte und wie seine Haut zu Wachs wurde, schmierig, glatt und tot.
Der Makler bedankte sich für Sanders Vertrauen. „Das Häuschen verkaufe ich Ihnen im Handumdrehen“, versicherte er. „Sie werden zufrieden sein.“
Sanders war bereits jetzt zufrieden. Er hatte seinen Notgroschen aus dem Tresor im Keller geholt und in einen an Silke adressierten Umschlag gesteckt. Dass er jetzt den Hausschlüssel abgegeben hatte, das war ihm das Wichtigste. Das Haus war bedeutungslos geworden. Kein Ort mehr.
„Kopf hoch, junger Mann.“ Die schwere Maklerhand mit den Siegelringen landete auf Sanders Schulter. „Machen Sie sich das Weihnachtsfest so angenehm wie möglich. Trinken Sie. Gehen Sie unter Menschen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche.“
Sanders nickte und wünschte dem Mann mit einer Lichtjahre entfernt klingenden Automatenstimme ein frohes Fest. Über den verschneiten Gartenweg ging er zurück zu seinem Wagen. Öffnete und schloss das Gartentor. Als er damals den Riegel an das Tor geschraubt hatte, hatte er ihn extra niedrig angebracht, damit sein Junge ihn leicht erreichen können würde, wenn er erst laufen gelernt hatte. Jetzt saß der Riegel einfach zu tief. Als sei er ein schlechter Handwerker gewesen.
Sanders nahm zum letzten Mal den längst abbestellten Tagesspiegel aus dem Briefkasten und stieg in sein Auto. Er musste einen Postkasten finden, der heute noch geleert wurde, damit Silke morgen an Weihnachten noch den Umschlag mit dem Geld bekam. Danach würde er seine Dienstwaffe im Präsidium abgeben, in seiner neuen Wohnung das Wasser abstellen, dann noch ein paar Zeilen aufsetzen, seine Mutter betreffend. Vielleicht würde Onkel Klaus sie zu sich nehmen. Alles andere würde Silke erben, und gut.
Und dann. Ja. Dann.
Sanders legte die Tageszeitung auf den Beifahrersitz. Er wusste plötzlich nicht mehr, warum er den Wagen starten sollte. Wenn er einfach hier sitzen blieb, würde er heute nacht erfrieren. Er konnte die Zeitung lesen, bis es soweit war.
Draußen lief der Makler vorbei, winkte fröhlich und fuhr davon.
Sanders‘ Haut, die ihm nicht mehr gehörte, schwitzte. Sie klebte tödlich kalt und feucht von innen am Futter seines Wintermantels. Sanders drehte den Rückspiegel so, dass er sein Gesicht sehen konnte. Eine verhärmte Maske, darunter ein verrottender Leichnam. Es war der Nachmittag des Tages vor Heiligabend, und er war ein toter Mann. So klar erkennbar, dass er sich wunderte, warum der Makler nichts weiter gesagt hatte. Aber vielleicht war der Mann einfach nur zu höflich gewesen.
Natürlich, auch sein Chef war ein anständiger Mensch, der einfach nur helfen wollte. Er hatte recht und Silke hatte recht. Sanders hatte viel zu lange darauf gewartet, dass die Dunkelheit aus ihm verschwand. Nun war ihm klar, dass er die Quelle dieser Dunkelheit war. Er wusste, er musste verschwinden. Nur wie?
Sein Blick fiel wieder auf den Tagesspiegel auf dem Beifahrersitz. „Das schwärzeste Schwarz“, titelte die Zeitung. Sanders blieb daran hängen. „Je finsterer die Nacht, umso heller die Sterne“, las er. „Aber wo ist der dunkelste Ort Deutschlands? Ein Forscher hat ihn entdeckt: Es ist Gülpe in Brandenburg, keine 80 Kilometer von Berlin. Nun soll dort der Sternenpark Westhavelland entstehen.“
Sanders schaltete die Innenbeleuchtung des Wagens ein und las den gesamten Artikel. Sein vollständig überflüssiges Atmen schlug sich an der Seitenscheibe als Eiskristallgardine nieder. Um sein Auto herum stieg von Osten die Nacht auf und fiel übers Land. Das fahle Licht des untoten Frosttages scheuchte sie vor sich her.
Eine Nacht ohne Dämmerung kam Sanders plötzlich wie ein Freund vor. Er tippte das Wort Gülpe in das Navi. Es zeigte ihm einen menschenarmen Flecken, gleich neben Orten wie Kotzen und Wassersuppe. Anderthalb Stunden Fahrzeit über schmale, schneeverschlagene Landstraßen. Zeit für einen letzten langen blauen Moment.
Der Wagen sprang an.
Die Nächte in Berlin seien lichtverschmutzt, hatte es in dem Artikel geheißen. Gerade jetzt zu Weihnachten mit Festbeleuchtung und Weihnachtsmärkten seien die Nächte zehnmal heller als noch vor 150 Jahren. Die Nacht sei vom Aussterben bedroht. Nun, Berlin, das war eh vorbei. Es war nicht mehr als eine glühend weiße Lichtglocke in Sanders Rückspiegel, die kleiner und kleiner wurde. Als er bei Rathenow auf das überfrorene Kopfsteinpflaster Richtung Gülper See abbog, verschwand die große Stadt schließlich hinter dem Horizont und erlosch.
Berlin, dachte Sanders, war überhaupt an allem Schuld. Er war nie richtig von Berlin losgekommen. Auch Jahre im Speckgürtel hatten ihm das Urbane nicht austreiben können. Den Kaffee, zum Beispiel. In Berlin hatte man zu jeder Tag und Nachtzeit und an jeder Ecke einen umwerfend aromatischen Caffè americano bekommen können. In Kotzen und Wassersuppe hielten sie Caffè americano wahrscheinlich für eine Schmugglerkneipe aus einem Humphrey-Bogard-Film.
Die Xenonscheinwerfer von Sanders‘ Wagen schnitten wie ein Laserskalpell durch tiefhängende Winternachtswolken. Es würde weiße Weihnachten geben. Es würde einfach sein. Er würde Vollgas geben, der Wagen würde durch das Eis des Gülper Sees brechen. Später würde Schnee fallen. Dann würden die Menschen sich um ihre leuchtenden Gabentische versammeln. Es würde still sein im Sternenpark Westhavelland, bis zum Frühjahr.
Das Schild tauchte unverhofft hinter einer Biege am Straßenrand auf: „Blue Mountain Café, 200 m rechts. Wir machen den besten Kaffee der Welt.“
Er hatte nur ein paar Sekunden für die Entscheidung. Noch einmal einen Kaffee trinken? Vielleicht sogar tatsächlich „den besten der Welt“? Blue Mountain, das war ein Kaffee so mild, dass Sanders ihn vielleicht ertragen würde. Ein Gourmetkaffee aus Jamaika. Kenner hielten ihn für den König der Kaffeesorten. In Sanders Gehirn regten sich Erinnerungen an einen reinen, edlen Geschmack. Als ein Leuchtschild von der Straße auf einen kleinen Parkplatz wies, stellte Sanders fest, dass irgendetwas in ihm heruntergeschaltet und den Blinker gesetzt hatte.
Das Blue Mountain Café war noch geöffnet. In der tiefen Abenddämmerung kam es ihm gemütlich vor, obwohl es nichts war als ein einsames Holzhäuschen, eine Mischung aus Ausflugscafé und Raststätte. Aber es wirkte gepflegt, die Weihnachtsbeleuchtung in den Fenstern dezent. Wieso er den Wagen abstellte und ausstieg, wusste Sanders nicht. Seine Hand drückte die Klinke zur Gaststube. Die wohlige Wärme roch nach Zimtsternen.
Sanders war der einzige Gast. Hinter dem Tresen sah eine Frau auf, als er eintrat. Sie war vielleicht fünfzig, auf selbstverständliche Weise hübsch und rotwangig. Wie machten das brünette Frauen nur, dass ihr Haar so glänzte. Zur Servierschürze trug diese hier einen selbstgestrickten Ringelpullover. Als Sanders fragte, ob er noch einen Blue Mountain bekommen könnte, lächelte sie, und beim Lächeln sah er einen blauen Swarovskistein, der als Verzierung auf einem ihrer Eckzähne klebte.
„Sind Sie von Berlin aus durchgefahren?“ Sie wies auf das Kennzeichen seines Wagens vor dem Fenster.
Er nickte.
„Ich mach uns ein bisschen Musik an“, sagte sie und verschwand in einer kleinen Küche. Kurz darauf sang Chris Rhea leise „Driving Home for Christmas“. Weder das eine noch das andere existiert wirklich, dachte Sanders.
Er setzte sich an einen der Bistrotische, auf denen Kerzen und Tannenzweige lagen, lehnte sich zurück und beobachtete, wie der abschmelzende Schnee rund um seine Budapester dunkle Wasserränder auf den rohen Holzdielen bildete.
Vielleicht waren ihm kurz die Augen zugefallen. Jedenfalls stand die Frau plötzlich neben ihm, in der Hand einen Keramikbecher mit Kaffee. Es roch nach Nebelbergen und Holzaromen.
„Unser Bester“, sagte sie und stellte den Becher vor ihm auf den Tisch. „So mild, und trotzdem weckt er Tote auf.“
Die Frau schob ihm einen Teller mit Keksen hin.
„Dattelkekse“, lächelte sie, zündete die Kerze an und setze sich zu ihm. „Unsere Oma bäckt sie jedes Jahr für die ganze Familie. Sie wird im Frühling 95. Fahren Sie auch nach Hause zum Fest?“
Nein, dachte Sanders. Ich fahre zur Hölle.
Trinken wir drauf.
Er hielt den Keramikbecher mit beiden Händen. Der Kaffeedampf stieg auf wie aus einer Opferschale. Der Blue Mountain war leicht und heiß. Er schmeckte samtig, nach Kakao und weihnachtlich-üppig nach Nüssen und rotem Sandelholz. Sanders vergaß sich selbst.
Er musste ein zufriedenes Gesicht gemacht haben. Die Augen der Frau leuchteten stolz, oder vielleicht war es auch nur das Flackern der Kerzenflamme. Sanders fragte sich, warum diese Frau dort sitzen blieb und ihm beim Kaffeetrinken zusah. Es erinnerte ihn an irgendetwas, etwas Friedliches, längst Vergangenes. Etwas, um das es sich zu kämpfen gelohnt hätte.
Die Frau beugte sich vertraulich vor. »Erstaunlich, nicht wahr? Überhaupt keine Säure. Und wirkt fast wie ein Zaubertrank. Er nimmt die ganze Bitterkeit und …«
Draußen auf dem Parkplatz kam Bewegung in die Dunkelheit. Motorengeräusche, Scheinwerfer flitzten durch die Fenster. Die Tür zum Café flog auf. Ein Windstoß löschte die Kerze.
Die Wirtin sprang auf. Neben dem Tresen erschien ein Mann, grobschlächtig, kräftig, in abgerissenem Parka und Armeestiefeln. Sein rotadriges Bartgesicht glänzte. In der Hand hielt er eine Walther PK.
„Ralf!“ Die Wirtin starrte auf die Waffe. »Nein. Bitte, Ralf, lass das!«
Die Augen des Mannes huschten zwischen Sanders und ihr hin und her. Sein bärtiger Kiefer mahlte. »Schnauze!«, blaffte er.
Sanders stellte seinen Becher ab und stand auf. Er war recht groß, das machte schon mal Eindruck.
Und Ralf war sternhagelvoll, aber seine Waffe hatte er entsichert. Er taumelte einen halben Schritt rückwärts und legte auf Sanders an. Nicht das erste Mal in Sanders Leben, dass jemand ihn abknallen wollte. Nichtmal das erste Mal in diesem Winter. Aber wie sagt man das, ohne allzu gelangweilt zu klingen?
„Gib mir das Ding lieber her.“ Sanders streckte die Hand aus. „Das macht so hässliche Löcher.“
Der Mann klappte den Mund auf. Rissige Lippen, schwarze Zähne und ein Geruch, als sei eine Dose Verdünnung ausgelaufen.
„Inga!“, stieß der Kerl hervor. „Du rückst jetzt sofort die Tageskasse raus. Mach hinne. Hab nicht ewig Zeit. Los, los!“
Sanders spürte, wie sich der Körper der Frau hinter seinen Rücken duckte. Gut.
„Mach keinen Quatsch, Ralf.“ Ingas Stimme war klein und gepresst. „Da ist doch gar nichts drin in der Kasse. So kurz vor Weihnachten. Da kommt doch keiner ins Café.“
„Erzähl kein Scheiß!“, geiferte Ralf. „Hol die Kasse, sonst knallt’s!“
„Ralf, ich …“
Ansatzlos drückte der Typ ab. Die Dielen vor Sanders Schuhen zerplatzten. Die Frau schrie und klammerte sich an seinen Mantel. Sanders staunte wie immer über die Wucht des Knalls.
„Ich mein das ernst, Frau. Kasse her. Is auch mein Geld.“
„Warum haust du nicht einfach ab? Du machst uns allen das Leben zur Hölle mit deiner Sauferei!“, schluchzte Inga hinter Sanders‘ Rücken.
Sanders griff nach hinten, bekam ihre Hand zu fassen. Die war heiß und nass und zuckte vor Panik.
„Deine Frau hat recht“, sagte Sanders. „Mach dich nicht unglücklich. Gib mir deine Waffe. Mit dem Griff nach vorne. Und dann gehen wir alle nach Hause und feiern Weihnachten.“
„Pah!“ Der Typ spuckte aus. „Was weißt du denn! Hab’s vom Parkplatz gesehen. Kommst aus Berlin hier her mit deiner fetten Karre und deinen piekfeinen Klamotten und willst dich an meine Olle ranschmeißen! Hab doch gesehen, wie ihr da so zusammen gesessen habt. Aber nich bei mir, du Arschloch! Ich knall dich ab, verstehste?“
Oh Gott, ja, dachte Sanders. Knall mich ab. Bitte.
Er machte einen Schritt auf den Mann zu, sorgfältig darauf bedacht, Inga mit dem Körper zu decken. Ihr Zittern spürte er durch seinen Mantel.
„Wozu brauchst du das Geld?“, fragte er.
Ralf fuchtelte fahrig mit seiner Walther vor Sanders Gesicht herum. „Maul halten!«, blaffte er. »Ich mach ernst! Hol die Knete, Inga!“
„Scheiß Weihnachten, hm?“ Sanders hob die Hände. „Kein Geld für Geschenke?“
„Hä?“ Ralf zog die Nase hoch. „Fresse halten!“
„Wie war das früher, Ralf? Hast du früher was Schönes zum Spielen für die Kinder besorgt? Und ein Halskette für deine Frau, mit einem kleinen goldenen Herz als Anhänger? Oder Parfüm? Habt ihr Rague Fin gegessen, Oh Tannenbaum gesungen und Händchen gehalten?“
Sanders wunderte sich über seine eigene Fantasie. Seine Kehle schmerzte ein bisschen, aber auch das würde bald vorbei sein.
Ralfs alkoholtrübe Augen wurden groß und größer. Sein Kinn begann zu zittern.
„Was hast du gearbeitet?“, fragte Sanders.
„Geht dich‘n Scheiß an! Inga, komm da weg von dem und hol die Knete!“
„Ich zum Beispiel bin Polizist“, sagte Sanders und ließ das erstmal wirken.
Ralfs Adamsapfel fing an zu hüpfen wie ein Jojo. Sein Wieselaugen flitzten, seine Mundwinkel wurden feucht. Er wischte sich die Nase am Parkaärmel ab.
„Hab ma Tischler gelernt“, sagte er. Zog mit einer Hand eine Taschenflasche hervor und nahm einen Schluck. „Aber hier ist jetzt zappenduster. Gibt keine Arbeit mehr für unsereins. Hier’s jetzt Sternenreservat. Die Macht der Nacht, verstehste? Schluss mit lustig. Astrotourismus. Wenn schon Dunkeldeutschland, dann wollen wir uns das wenigstens bezahlen lassen. Da kommen die alle her, aus Amerika und so, und starren den scheiß Saturn an. Kacken in die Büsche, die Autobässe wummern die ganze Nacht. Is nich lustig.“
„Was sollte lustig sein am Saturn?“
Ralf kam ins Plaudern. „Früher hab ick auch ein Teleskop gehabt. Vom Geld für die Jugendweihe gekauft. Mit Inga im August das Sommerdreieck angeschaut. Das ist schon groß, Mann.“
„Ich hab nur 35 Euro in der Kasse“, schluchzte Inga hinter Sanders Rücken.
„Großer Moment, verstehste, Bulle? Der Himmel wird schwarz, und die Sterne fallen bis zum Boden. Sternschnuppen, wünsch dir watt, det ganze Programm. Für einen Moment weißte nich, wo ist oben und wo ist unten. Hast du schon mal die Milchstraße gesehen, Bulle?“
„Nur die Friedrichstraße.“
„Als hätte man eine Lastwagenladung Diamanten verschüttet“, flüsterte Inga.
„Pass auf. Ralf.“ Sanders‘ Kaffee wurde kalt. Er musste das hier beenden. „Ich habe einen Briefumschlag mit tausend Euro in meiner Manteltasche. Den geb ich dir, und du gibst mir deine Knarre.“
„’nen Tausi?“ Ralfs Augen wurden schmal wie Wundnähte.
Sanders nickte. „Bedingung: Du teilst ihn mit deiner Frau.“
„Scheiße.“ Ralf lacht. „Bist verliebt in se, wa? Willst, dassse versorgt is, wenn ich dich abknalle, wa?“
„Ich greife jetzt ganz langsam in meine Manteltasche und hole den Umschlag raus.“ Sanders demonstrierte Ralf die Leere seiner rechten Hand wie ein Rummelzauberer. Mit Daumen und Zeigefinger ertastete er den Rand des Umschlags und zog ihn aus dem Mantel wie ein magisches Kaninchen.
„Deine Kohle, Ralf. Dein Weihnachten. Und jetzt sicherst du deine Knarre und gibst sie mir. Langsam.“
Ralf passte was nicht. Seine Iris überfror wie ein Dorfteich im Dezember.
„Inga“, befahl Ralf. „Komm hinter dem Bullen vor und nimmt ihm den Umschlag ab. Schau rein und zähl nach.“
„Machen Sie‘s nicht“, warnte Sanders.
Aber sie ist schon da, neben ihm, schnappt sich den Umschlag, reißt ihn auf. „Echt, Ralfi.“ Inga strahlt. „Ist wirklich Geld drin.“ Ihre roten Backen glühen.
Ralfs Waffenarm wird schlagartig gerade und ruhig. Die Mündung schwenkt zwanzig Grad zur Seite, auf die Stirn seiner Frau. Seine Blutaugen loggen das Ziel ein. Sein Zeigefinger wird krumm. Eine Zehntelsekunde zu langsam.
Sanders hat seine Dienstwaffe schon in der Hand, bevor er Inga aus der Schusslinie tritt. Sein Zeigefinger kennt keine Hemmungen, keine mangelnde Routine. Er schießt auf die Beine. Natürlich. Ralfs Oberschenkel knickt weg, der Mann taumelt gegen die Wand, brüllt wie ein Tier. Reißt sein Waffe hoch. Sanders sieht das Mündungsfeuer, spürt den Schlag an der Schulter, bevor es knallt. Holz splittert. Sanders lässt sich fallen, rollt ab. Im Fallen zieht er den Abzug zweimal durch. Ralf reißt Augen und Mund auf. Schaut erstaunt an sich runter, seine Pistolenhand zuckt unkontrolliert. Dann rutscht er langsam an der Wand ab. Zieht einen breiten roten Streifen auf der Tapete. Hustet blasiges Blut. Rudert noch ein bisschen hilflos mit den Beinen, wie sie es immer machen. Sein Parka färbt sich dunkel. Dann tut Ralf seiner Frau einen letzten Gefallen und stirbt ohne weiteres Theater. Seine ganze manische Energie bündelt sich, bebt noch für eine Zehntelsekunde um seinen Körper, dann schießt sie los und trifft Sanders mitten in die Brust.
Sanders presst sich an die Dielen. Ralfs Hass schüttelt ihn so lautlos und explosiv wie eine sterbende Sonne. Mühsam kommt er auf die Beine. Sichert seine Waffe und steckt sie in den Mantel.
Ruhig war es auf einmal. Die Frau – Inga – stand da mit offenem Mund. Atmete. Starrte. Vollkommen leeres Schockgesicht. Hundertmal hatte Sanders Leute so starren gesehen, tränenlos, von der Endgültigkeit gebannt. Die letzten Takte von White Christmas verklangen im Hintergrund: May all your days be merry and bright.
Sanders klopfte sich den Staub vom Mantel. Sein Ärmel war an der Schulter zerfetzt, darunter ein diffuser Schmerz. Nichts, was jetzt eine Rolle spielte.
„Ist er tot?“, fragte Inga so leise, als könne Ralf sie noch hören.
Sanders nickte. „Ich rufe jetzt die Kollegen. Die regeln alles weitere für Sie. Haben Sie jemanden, bei dem Sie heute nacht schlafen können, oder brauchen Sie professionelle Hilfe?“
Inga nickte, schüttelte den Kopf und zitterte dabei so sehr, dass Sanders ihre Zähne klappern hörte. Während er die Nummer des Präsidiums wählte, dachte er, dass jemand diese Frau dringend in den Arm nehmen sollte. Er hätte das selbstverständlich sofort erledigt, aber da war noch dieses winzig kleine Problem, dass er tot war und seine Haut eiskalt.
Der Beamte vom Dienst meldet sich. Sanders forderte eine Mordkommission und die SpuSi an, RTW nicht mehr nötig. Und langsame Anfahrt, bitte. So kurz vor dem Fest. Nein, sagte er, er könne nicht versprechen, dass er hierbleibe, bis die Kollegen eintrafen. Ex-Kollegen. Wie auch immer.
„Ist das wirklich passiert?“, fragte Inga plötzlich. Sie schlang die Arme um die eigenen Schultern.
Sanders hielt den kleinen Finger in seinen Kaffee. Kühl, aber noch trinkbar. Und wirklich keinerlei Bitterkeit.
Sechs Schüsse. Ein Toter. Blut. Ein Umschlag mit Geld. Das hatte was von Realität. Schwer vorstellbar, dass die Nacht vor dem Fest ihm hier eine Tragödie vorgespielt haben sollte. Jemand war tot, und dieser jemand war nicht er. Nun gut.
Sanders nahm einen Keks. „Der Blue Mountain“, sagte er, „war der Lieblingskaffee von James Bond in den Romanen von Ian Fleming, wussten Sie das?“
Inga schüttelte den Kopf.
Er drückte ihr den Geldumschlag in die Hand. „Stimmt so.“
Auf dem Parkplatz war es schwarzdunkel. Der Himmel explodierte mit glitzernden, blinkenden Sternenbändern. Ein Komet, eine Supernova, oder Jupiter und Saturn im Sternbild Fische. Was Sanders von Astronomie wusste, hatte er aus Startrek.
„Der Polarstern“, sagte die Stimme der Frau hinter ihm. Sie zeigte auf einen besonders hellen Fleck dicht über dem Horizont. »Früher dachte ich immer, das ist der Weihnachtsstern. Als ich Ralf das erzählt habe, hat er nur gelacht.«
»Wer zuletzt lacht.« Sanders hob die Schultern. Ein schwaches Echo von Ralfs Bösartigkeit durchstriff ihn. Zwischen den Alleebäumen in der Ferne flackerten die Blaulichter der anfahrenden Funkwagen wie Elmsfeuer.
Die Frau strich sich die Haare aus der Stirn. »Vielleicht sind Sie ja demnächst mal wieder in der Gegend«, sagte sie.
Sanders stieg in den Wagen.
„Gruß an die Oma“, sagte er:
Das satte Geräusch, mit dem die Autotür zufiel, schloss die Welt aus. Sanders steuerte seinen Wagen wie eine Raumkapsel durch eine Nacht aus gefrorenen Sternen, durch eine Antimateriewelt voller Bleimonde, die nichts mehr mit ihm zu tun hatte.
Wie von alleine fand Sanders’ Wagen den Weg Richtung Firmament. Ab Rathenow schmerzte sein Arm nicht mehr. Die Lichtglocke Berlins zeichnete sich als grünliches Leuchten ab, schön wie ein Polarlichtschleier. Fachleute nannten das Airglow, hatte er gelesen. Nur sichtbar, wenn der Himmel dunkel war. Extrem dunkel. Und mit jedem Lichtjahr Dunkelheit, das er zwischen sich und das einsame Café legte, pumpte sein Herz mehr von dieser rohen Energie, diesem Echo des Tötens aus seiner Brust in seine Haut, eine uralte Melange aus Macht, Wagemut, Zufriedenheit.
Im Grunde, dachte Sanders, trauert man ja doch immer nur um sich selbst.

 Auch im März 2016: Lesung im tollen Veranstaltungsraum der Dorotheenstädtischen Buchhandlung bei Buchhändlerlegende Klaus-Peter Rimpel! Danke!
Auch im März 2016: Lesung im tollen Veranstaltungsraum der Dorotheenstädtischen Buchhandlung bei Buchhändlerlegende Klaus-Peter Rimpel! Danke!


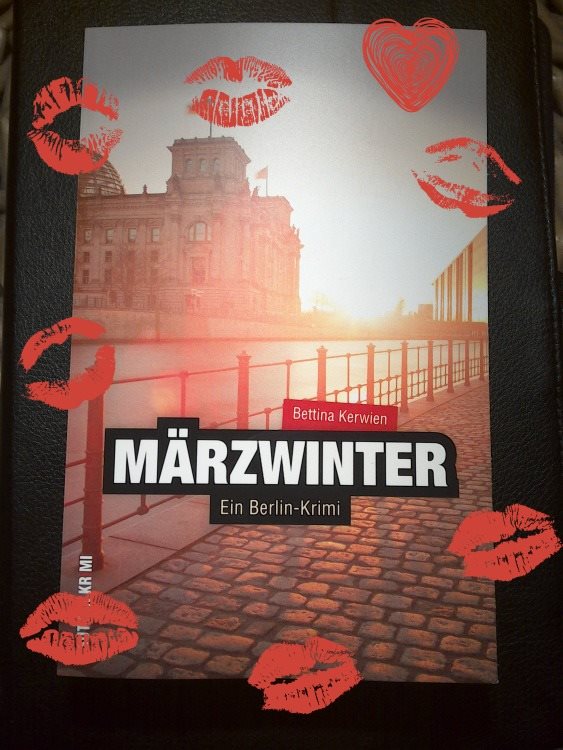
 Ich habe ein Buch „fertig“. Hurra! Fertig! – Na ja. Fertig ist halt immer relativ. Und will man eigentlich fertig sein? Ich vermisse meine Hauptfiguren. Martin Sanders?! Bleib bei mir! – Ehrlich, dieser Typ geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Da hilft nur: weiterdenken. Und da kommt dann eine Ahnung von einem weiteren Anfang heraus, und die geht so:
Ich habe ein Buch „fertig“. Hurra! Fertig! – Na ja. Fertig ist halt immer relativ. Und will man eigentlich fertig sein? Ich vermisse meine Hauptfiguren. Martin Sanders?! Bleib bei mir! – Ehrlich, dieser Typ geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Da hilft nur: weiterdenken. Und da kommt dann eine Ahnung von einem weiteren Anfang heraus, und die geht so: Meine arme Hauptfigur, die freche Stewardess Liberty Vale, ahnt noch nicht, was ihr blüht, als es mit dem „Märzwinter“ losgeht. Aber ich ahne: Es wird wieder ein ausgesprochen netter und interessanter Abend in der Humboldt-Bibliothek. Das Publikum ist immer sehr interessiert an den ersten Schritten der „VHS-Erfolgsautoren“
Meine arme Hauptfigur, die freche Stewardess Liberty Vale, ahnt noch nicht, was ihr blüht, als es mit dem „Märzwinter“ losgeht. Aber ich ahne: Es wird wieder ein ausgesprochen netter und interessanter Abend in der Humboldt-Bibliothek. Das Publikum ist immer sehr interessiert an den ersten Schritten der „VHS-Erfolgsautoren“ 

 geboren 1977 in Langen bei Frankfurt, ist Schriftsteller, Musiker und passionierter Kaffeetrinker. Nach Schwarzspeicher, dem einzigen Roman über die Post-Snowden-Ära, der schon vor den Snowden-Enthüllungen erschienen ist, legt er mit Amoralisch seinen zweiten Spannungsroman vor.
geboren 1977 in Langen bei Frankfurt, ist Schriftsteller, Musiker und passionierter Kaffeetrinker. Nach Schwarzspeicher, dem einzigen Roman über die Post-Snowden-Ära, der schon vor den Snowden-Enthüllungen erschienen ist, legt er mit Amoralisch seinen zweiten Spannungsroman vor. 10. März 2016, Humboldt-Bibliothek, Berlin-Tegel: 21 Autoren lesen je einen Text mit einer Länge von maximal 3.000 Zeichen, dazwischen spielt die Musik, 100 Leute schauen gebannt zu. Und das seit sieben Jahren in jedem Frühjahr. Klingt verrückt? Ist aber so. Die Teilnehmer der Volkshochschulkurse von Claudia Johanna Bauer arbeiten in jedem Jahr darauf hin, auf diese drei Minuten im Fokus der Aufmerksamkeit des Publikums auf der Bühne der Bibliothek. Zuerst wird über das Thema abgestimmt (in diesem Jahr war es „Begegnungen“), dann werden Texte hin- und hergemailt, es fließt eine Menge Schweiß und Herzblut, manchmal sicherlich auch etwas anderes. Heraus kommt Literatur. Kleine Perlen, die schimmern und funkeln. Manchmal vielleicht die Saatkörner für Größeres, manchmal stehen die Texte einfach nur für sich.
10. März 2016, Humboldt-Bibliothek, Berlin-Tegel: 21 Autoren lesen je einen Text mit einer Länge von maximal 3.000 Zeichen, dazwischen spielt die Musik, 100 Leute schauen gebannt zu. Und das seit sieben Jahren in jedem Frühjahr. Klingt verrückt? Ist aber so. Die Teilnehmer der Volkshochschulkurse von Claudia Johanna Bauer arbeiten in jedem Jahr darauf hin, auf diese drei Minuten im Fokus der Aufmerksamkeit des Publikums auf der Bühne der Bibliothek. Zuerst wird über das Thema abgestimmt (in diesem Jahr war es „Begegnungen“), dann werden Texte hin- und hergemailt, es fließt eine Menge Schweiß und Herzblut, manchmal sicherlich auch etwas anderes. Heraus kommt Literatur. Kleine Perlen, die schimmern und funkeln. Manchmal vielleicht die Saatkörner für Größeres, manchmal stehen die Texte einfach nur für sich.



 Mein aktuelles Projekt ist ein weiterer Krimi mit meinen Lieblingsfiguren, der Berliner Escort-Lady Liberty Vale und dem Privatdetektiv Martin Sanders. Die Einleitung steht, und jetzt hat es auch einen Titel: „Mord in Bestlage“.
Mein aktuelles Projekt ist ein weiterer Krimi mit meinen Lieblingsfiguren, der Berliner Escort-Lady Liberty Vale und dem Privatdetektiv Martin Sanders. Die Einleitung steht, und jetzt hat es auch einen Titel: „Mord in Bestlage“. Habt Ihr wirklich geglaubt, dass ich mir das alles nur ausgedacht habe?
Habt Ihr wirklich geglaubt, dass ich mir das alles nur ausgedacht habe? eibwerkschau der VHS Reinickendorf geht in die 7. Runde! Jedes Jahr im März zeigen die Teilnehmer der Schreibkurse von Claudia Johanna Bauer, was sie können. Und das kann erotisch, abenteuerlich oder poetisch sein. Jeder Text ist nicht länger als 3.000 Zeichen, was einer Lesezeit von etwa 2 Minuten entspricht. Alle Autoren schreiben zu einem Thema, und das lautet in diesem Jahr „Begegnungen“. Die Vortragenden stehen am Lesepult oder sitzen, wandern durch das Publikum – manche verkleiden sich auch, singen, treten zu zweit auf oder machen Musik. In der Pause kann man ein Weinchen und einen kleinen Imbiß verkosten. Und da mittlerweile vier veröffentliche Autoren unter den Teilnehmern sind, gibt es einen Büchertisch mit Werken von:
eibwerkschau der VHS Reinickendorf geht in die 7. Runde! Jedes Jahr im März zeigen die Teilnehmer der Schreibkurse von Claudia Johanna Bauer, was sie können. Und das kann erotisch, abenteuerlich oder poetisch sein. Jeder Text ist nicht länger als 3.000 Zeichen, was einer Lesezeit von etwa 2 Minuten entspricht. Alle Autoren schreiben zu einem Thema, und das lautet in diesem Jahr „Begegnungen“. Die Vortragenden stehen am Lesepult oder sitzen, wandern durch das Publikum – manche verkleiden sich auch, singen, treten zu zweit auf oder machen Musik. In der Pause kann man ein Weinchen und einen kleinen Imbiß verkosten. Und da mittlerweile vier veröffentliche Autoren unter den Teilnehmern sind, gibt es einen Büchertisch mit Werken von: Ich weiß, ich bin spät dran. Zwanzig Jahre zu spät, wenn man es genau nimmt. Denn über die Feiertag habe ich jetzt doch endlich Jonathan Lethems 1994er Debütroman „Gun, with occational music“ beendet. Nicht, dass ich zwanzig Jahre an dem Buch gelesen hätte. Nein. Ich habe Lethem einfach zwanzig Jahre zu spät entdeckt.
Ich weiß, ich bin spät dran. Zwanzig Jahre zu spät, wenn man es genau nimmt. Denn über die Feiertag habe ich jetzt doch endlich Jonathan Lethems 1994er Debütroman „Gun, with occational music“ beendet. Nicht, dass ich zwanzig Jahre an dem Buch gelesen hätte. Nein. Ich habe Lethem einfach zwanzig Jahre zu spät entdeckt.






